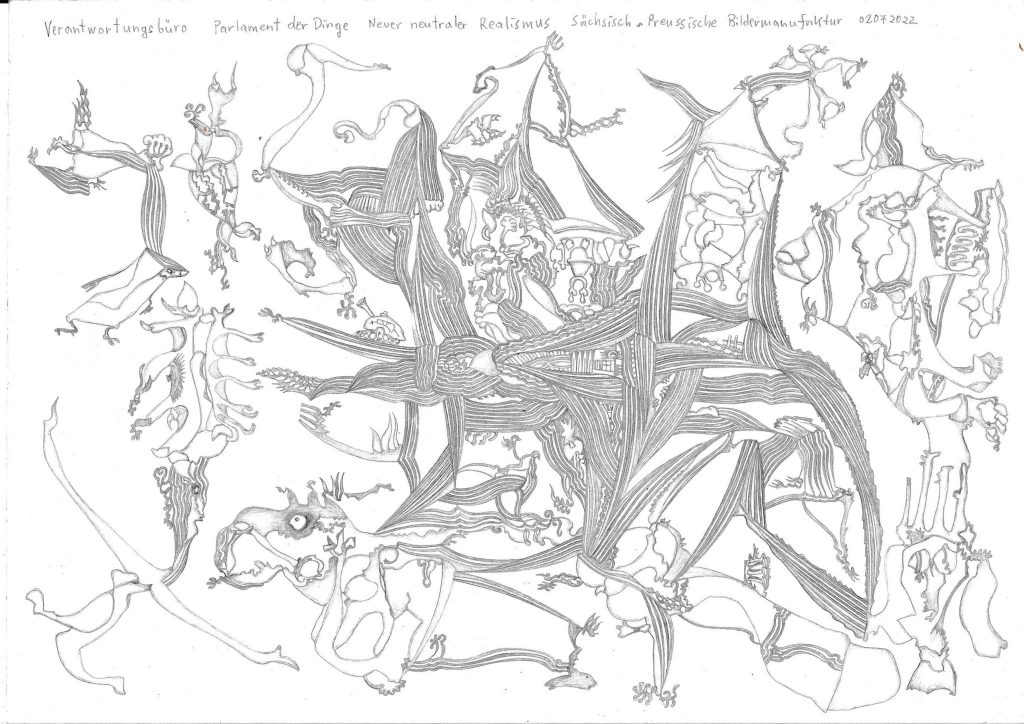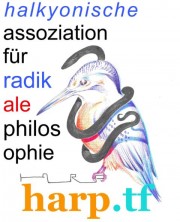Mein versprochenes Manifest aus meinem Vortrag Nietzsche – Für eine Ethik des kritischen Individualismus II (Link).
Bekenntnis einer demokratischen Drecksau
Oink, oink!
Seht her, ich bin kein Mensch,
Ich bin eine demokratische Drecksau.
Du, erhabener Edelmensch, hast nichts als Verachtung für mich übrig.
Ich bin hässlich, missraten und schwach.
Du hältst dich für frei, stark, souverän und nennst mich Canaille. Einen wutschnaubenden Fanatiker, attestiert mir einen krankhaften Geist.
Leicht könnte ich dir vorhalten, dass du dich selbst beschreibst, wenn du über mich wütest und das Rutenbündel brichst.
Aber das wäre einfach, allzu einfach.
Ich empfinde in Wahrheit weder Verachtung noch Wut, wenn ich dich betrachte, sondern etwas, was du dir eisern abgewöhnt hast, Mitleid.
Du bist nicht frei, du suchst nur nach der Freiheit.
Auch ich bin nicht frei, ich suche nach der Freiheit.
Doch anderswo als du.
Ich suhle mich bei meinen Mitschweinen im Dreck, ich liebe meine Borsten, ich wühle den Boden nach Eicheln.
Ich atme die Luft des Waldes und bin bei den Waldgeistern zu Haus.
Du fliegst eilig über uns hinweg und machst große, hastige Sprünge.
Etwas treibt dich, lässt dir keine Ruhe.
Ist es das, was man „Gewissen“ nennt und was du an dir verachtest und mit allem Peitschenknall nicht übertönen kannst?
Eine Mutter hat dich gesäugt, wie auch mich, und das wurmt dich.
Diese Gleichheit mit mir, die dich aus der erhabenen Stimmung der Einsamkeit reißt.
Sehen wir uns nicht zum Verwechseln ähnlich?
Zögest du einmal deine liebgewonnene Uniform aus, entledigtest du dich deines glitzernden Säbels, stutztest du deinen mächtigen Schnurrbart, der dich mit den Großen verbindet – wärst du ganz nackt, man könnte uns glatt für Brüder halten.
Aber du hast weder Mutter noch Bruder. Elternlos braust du, einer Wolke gleich über den Wald hinweg. Immer höher zu größerer Freiheit, immer weiter entfernt vom Moos und den Farnen.
Hier im Wald ist niemand Souverän, niemals, und deine Rute dient uns als nächtliches Feuer, in dessen Schein wir uns wärmen und berichten, was uns die Waldgeister sagten.
Hier im Wald bildet alles ein großes Geflecht und es gibt keine Herrschaft.
Die Bäume recken sich empor, morgen schon sind sie Nahrung für Pilze und Würmer.
Und alle ernährt die Sonne, der Wind, der Regen und die große Mutter, die Erde.
Oink, oink!
Ich suhle mich bei meinen Mitschweinen im Dreck, ich liebe meine Borsten, ich wühle den Boden nach Eicheln.
Gäbe es noch einen Gott, wünschte ich dir trotz allem einen Platz im Himmel.
Doch du hast ihn getötet, leer ist dein Auge seitdem.
Nackt sind wir hier alle, wenn der Regen auf uns herabfällt und der gesamte Wald atmet.
Dann wird es kalt und nass und wir verkriechen uns ins Gebüsch, sind ganz eng beieinander.
Kennst du das, diese Enge? Du fliehst sie, wo du nur kannst.
Dein Gott ist tot und mit ihm starb auch dein Nächster.
Ein Geist bist du selbst, schwarz und stolz, einer Krähe gleich.
Du denkst, du wärst frei, doch willst doch nur, dass wir Schweine uns über dich ärgern.
Manchmal klappt’s und wir tun dir den Gefallen.
Aber eigentlich bist du uns ziemlich egal, du armes Schwein.
Spotte nur über unsere Enge im Wald und unsere Vorliebe für die Eicheln – manchmal entdecken wir auch einen Trüffel.
Auch sind wir nicht ohne Träume.
Wir sammeln uns auf der Lichtung, wenn Fuchs und Hase sich grüßen, wir lauschen den Geistern des Waldes.
Sie schicken uns Bilder von kommenden Welten, für die du keinen Sinn hast. Bilder der Zärtlichkeit und des Friedens, des kommenden Glückes, eine Welt ohne Wölfe und Adler. Gleich Tautropfen in Spinnennetzen funkeln sie uns und geben uns Hoffnung, lassen auch unsere Äuglein strahlen.
Wir schützen uns vor den Wölfen und Adlern,
denen du Freund bist.
Wenn der Wald brennt, ist es für dich nur ein weiteres Schauspiel,
uns macht es Angst, weil wir wissen, was du nicht weißt:
Dass es uns in der Aschenwüste nicht gäbe.
Komm, Freund, gesell dich zu uns,
wenn dich deine wilden Hunde genug gehetzt haben.
Lausche den Geistern des Waldes,
hör auf die Tropfen des Regens,
sei ein Schwein unter Schweinen,
grunze mit uns im Chor,
suhl dich im Dreck,
suche die Eicheln,
finde die Trüffel,
lieb deine Borsten.
Oink!