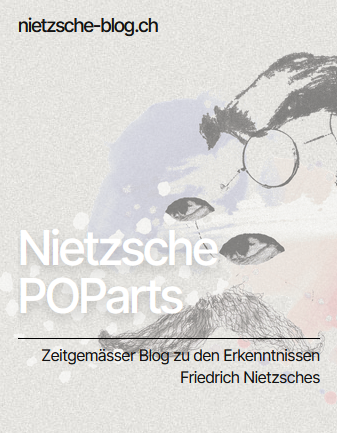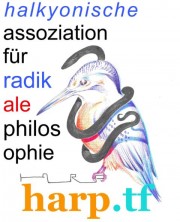Ein Gastbeitrag von Hans-Martin Schönherr-Mann, Professor für politische Philosophe an der LMU München.
Nietzsche und die Kriege
Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt zwei Jahre, halb so lange wie der Erste Weltkrieg und er scheint sich ähnlich zu entwickeln. Das Ganze ist mehr als peinlich für Russland, das nicht mal die Ukraine zu erobern vermag, was wiederum beruhigend für die EU wäre, deren Militärpolitiker sich indes davon gar nicht beruhigen lassen wollen, sondern eine ‚Zeitenwende‘ ausrufen. Die Politik darf sich nicht mehr am Frieden als Normalzustand orientieren, sondern am Ausnahmezustand, dem Krieg.
Vielleicht haben sie Nietzsche gelesen, der 1888 in der Götzen-Dämmerung schreibt: „Die Völker, die Etwas werth waren, werth wurden, wurden dies nie unter liberalen Institutionen; die grosse Gefahr machte Etwas aus ihnen, das Ehrfurcht verdient, die Gefahr, [. . .] die uns zwingt, stark zu sein.“ (Streifzüge, 38) Nietzsche ist nicht der einzige, der den Krieg als Wegbereiter der Tugend proklamiert. In Also sprach Zarathustra untermauert Nietzsche das: „Der Krieg und der Muth haben mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer Mitleiden, sondern eure Tapferkeit rettete bisher die Verunglückten.“ (Vom Krieg und Kriegsvolke)
Von Seiten der Ukraine hieß es unlängst, man dürfe noch keinen Frieden schließen, der nur Russland erlaube, aufzurüsten um erneut anzugreifen. Dabei lässt sich eine spätere Aufrüstung schwerlich verhindern. Zwar ist es verständlich, dass das angegriffene, erheblich kleinere und viel schwächere Land einerseits Sicherheiten braucht, nicht wieder angegriffen zu werden und andererseits die russischen Eroberungen rückgängig machen möchte, wiewohl letzteres von Anfang an vermessen war.
Der Krieg in Gaza dauert seit dem Überfall der Hamas auch schon ein halbes Jahr. Die Zeiten, als Israel noch Blitzkriege führen konnte, sind offenbar vorbei. Freilich ist Blitzkrieg nur ein Mythos. Als die Nazi-Deutschen propagierten, solche zu führen, handelte es sich um eine nachträgliche Interpretation, die auch den Unterlegenen zupass kam. Denn Blitzkriege lassen sich nicht planen. Alle wollen den schnellen Sieg: die Russen, die Ukrainer, die Israelis und die Hamas kämpft bis zum Untergang. Niemand wird sein Ziel erreichen, nicht mal den Untergang.
Doch alle diese Ziele entsprechen einer Logik, die Kriege verschärft und unendlich verlängert. Die Frage stellt sich, ob es politisch verantwortungsvoll ist, einer solchen Logik zu folgen, d. h. ob ein Krieg nicht zu zerstörerisch ist, zu viele Opfer fordert, wenn man glaubt, ihn gewinnen zu müssen. Sollte man im Krieg nicht primär nach Wegen zum Frieden suchen, auch wenn man dazu unerfreuliche Kompromisse machen muss? (Weiterlesen)